
Das Mühlviertel wird im Süden von der Donau begrenzt. Diese bildet im Bereich von Schlögen eine Flussschlinge, die zu den imposantesten Naturwundern unserer Heimat gehört. Besonders wertvoll sind auch die Hang- und Schluchtwälder im Donautal.

Im Norden sind noch große, weitgehend geschlossene Waldgebiete erhalten, beispielsweise der Böhmerwald. Hier sind ökologische Kostbarkeiten wie Luchs, Elch, Rothirsch und Auerhuhn beheimatet.

Dazwischen liegt eine Kulturlandschaft, die zumindest mancherorts noch struktur- und artenreich ist. Das Landschaftsbild wird hier von sanften Hügeln, kleinen Wäldern, Wiesen, Feldern, Hecken, Rainen, Bächen und Ortschaften geprägt.

Um unsere Tier- und Pflanzenwelt zu verstehen, muss man sich mit dem „Urzustand“ unserer Lebensräume und ihrer Veränderung im Laufe der letzten Jahrhunderte auseinandersetzen.

Vor der Rodung durch den Menschen war das Mühlviertel fast vollständig von Wald bedeckt. Lediglich Moore waren waldfrei, da auf den nassen Böden keine Bäume gedeihen konnten.

In diesem Urwald gab es vom Tiefland bis in die Hochlagen eine natürliche Abfolge vom Laubwald über Mischwald bis zum reinen Nadelwald. Auch kleinräumig lebten je nach Boden und Klima unterschiedliche Pflanzen- und Tierarten.

Der Wald war ursprünglich nicht überall geschlossen und "finster". Vielmehr sorgten große Pflanzenfresser wie Wisente zumindest stellenweise und vorübergehend für relativ lichte Waldbereiche, in denen auch "Offenlandarten" Lebensraum fanden.

Archäologische Funde zeigen, dass es im Bereich des heutigen Mühlviertels schon seit Jahrtausenden vereinzelt Menschen gab. Diese Pfeilspitzen und Steinwerkzeuge aus der Steinzeit wurden auf einem Acker in der Nähe der Donau gefunden.

Systematisch gerodet und für den Menschen erschlossen wurde das Mühlviertel allerdings erst relativ spät. Dieses Bild zeigt die heutige Kulturlandschaft im Bereich von Ödenkirchen, einer der ersten Rodungsinseln im nordwestlichen Mühlviertel.
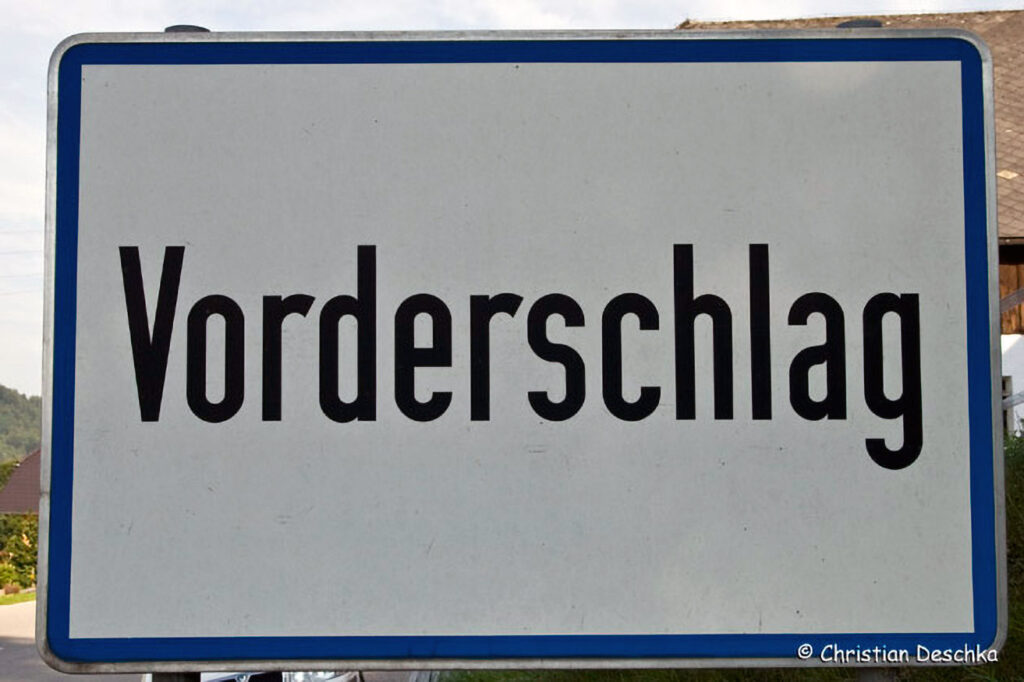
Noch heute geht aus vielen Ortsnamen die Art der Rodung hervor: Die häufige Endung –schlag ist beispielsweise darauf zurückzuführen, dass hier der Wald mit Hilfe der Axt gerodet wurde.

Gerodet wurden natürlich bevorzugt jene Waldbereiche, die wenig Steine aufwiesen. Dennoch mussten viele Steine ausgegraben und z.B. mit Schlitten beiseitegeschafft werden. Sie wurden an den Grundstücksgrenzen zu Rainen aufgeschichtet.

Sie prägen bis heute das Land- schaftsbild und sind auch für Pflanzen und Tiere wichtige Lebensräume.

Die verbliebenen Wälder sind heute oft reich an Steinen und Felsen aus Granit und Gneis. Ab und zu findet man sogar solche Blockfelder. Die rundlichen, moosbewachsenen Steine geben unseren Wäldern ein typisches Erscheinungsbild.

Es ist heute für viele nicht mehr vorstellbar, dass ursprünglich bei uns auch Großraubtiere wie Braunbär, Wolf und Luchs flächendeckend verbreitet waren. Sie sind wichtige Bestandteile mitteleuropäischer Ökosysteme, die heute großteils fehlen.

Den ersten Siedlern fiel es oft schwer hier Fuß zu fassen. Kein Wunder, dass die Natur als etwas Feindliches betrachtet wurde. Aus damaliger Sicht war es selbstverständlich, Konkurrenten wie den Wolf unter Einsatz solcher Wolfsgruben auszurotten.

Auch die gefürchteten Braunbären mussten allesamt ihr Leben lassen. Der letzte Mühlviertler Braunbär wurde 1833 in Ulrichsberg erlegt und kann heute im Museum des Stiftes Kremsmünster besichtigt werden.

Die Landwirtschaft stellte lange Zeit ein extrem mühsames Unterfangen dar. Dort beschäftige Menschen mussten großteils für ihr tägliches Brot arbeiten. Von den damaligen Lebensumständen kann man sich heute in Freilichtmuseen ein Bild machen.

Im Vergleich zu heute erfolgte die landwirtschaftliche Bewirtschaftung bis Mitte des 20. Jahrhunderts sehr extensiv – mit Pferden und Ochsen, in Handarbeit, mit minimalem Maschineneinsatz, ohne Mineraldünger, …

Die Mahd der Wiesen wurde ursprünglich in Handarbeit mit der Sense ein- bis zweimal pro Jahr durchgeführt. Gedüngt wurde – wenn überhaupt – mit wenig Stallmist. Diese Bewirtschaftung führte zu relativ mageren, artenreichen Wiesen.

Diese extensive Grünlandbewirtschaftung kam beispielsweise dem Birkhuhn sehr entgegen. Es hatte im geschlossenen Wald die wenigen Moorränder besiedelt und fand nunmehr neuen Lebensraum an den Rändern extensiver Feuchtwiesen.

Die Trockenlegung von "sauren" Feuchtwiesen durch großfächige Drainagierungen, die Beseitigung von Rainen und die häufigere Mahd waren ausschlaggebend dafür, dass das Birkhuhn aus unserer Kulturlandschaft verschwand.

Lange Zeit baute jeder Bauer für den Eigenbedarf eine Vielzahl an Fruchtsorten auf kleinen Feldern an. Daraus resultierte eine extrem abwechslungsreiche Kulturlandschaft, die Feldhase, Rebhuhn & Co idealen Lebensraum bot.

Aufgezeichnete Erlegungszahlen dieser Arten belegen, dass es früher in Folge kleinster Parzellengrößen, hoher Fruchtvielfalt, seltener Mahd per Hand, rücksichtsloser Beutegreiferbekämpfung und niedrigem Verkehrsaufkommen wesentlich höhere Dichten gab.

Mit dem Einsatz von Taktoren und einer zunehmenden Anzahl von Maschinen wurde die landwirtschaftliche Arbeit extrem erleichtert und beschleunigt. Diese Effizienzsteigerung bewirkte zahlreiche ökologische Veränderungen.

Um effizienter arbeiten zu können, wurden Raine beseitigt und die entstandenen, größeren Grundstücke neu verteilt. So entstanden aus kleinen Flächen mit unterschiedlicher Bewirtschaftung größere Bewirtschaftungseinheiten.

Das Landschaftsmosaik veränderte sich damit drastisch zum Nachteil der Tiere. Es gab nicht nur weniger Feindschutz bietende Strukturen wie Hecken, sondern es vereinheitlichte sich auch die räumliche und zeitliche Verteilung der Bewirtschaftung.

Und deshalb finden wir heute vielerorts eine ausgeräumte, monotone Landschaft. Diese ist zwar für den Landwirt leichter zu bewirtschaften, bietet aber Pflanzen und Tieren weniger Lebensraum.

Durch Hecken und Raine reich gegliederte Landschaften wie hier im Landschaftsschutzgebiet Ödenkirchen im Norden des Bezirkes Rohrbach sind heute auch im Mühlviertel die Ausnahme.

Auch solche vom Bauern gepflegte Streuobstwiesen mit alten, hochstämmigen Obstbäumen sind heute schon eine Besonderheit. Sie liefern nicht nur Obst, sondern sind auch Lebensraum für Pflanzen und Tieren und tragen obendrein zum schönen Landschaftsbild bei.

Auch Hohlwege mit ungedüngten Böschungen ("Gsteckn") sind wertvolle Lebensräume, beispielsweise für Insekten. Die alten Obstbäume sind eine weitere Aufwertung - auch optisch.

Leider gehen noch immer wertvolle Teile unserer Kulturlandschaft verloren. Z.B. werden vielerorts derart schöne Kulturterrassen in Fichtenäcker verwandelt. Weitere Borkenkäferprobleme und Sturmschäden werden damit vorprogrammiert...

Auch die illegale Beseitigung von Rainen hat noch nicht aufgehört. Indem alljährlich dort und da ein wertvolles Kulturlandschaftselement verschwindet, wird die alte Kulturlandschaft schleichend in eine intensive Agrarsteppe verwandelt.

Für engagierte Landwirte, Jäger und andere Naturfreunde gibt es heute eine Reihe von Förderinstrumenten, die in solchen Fällen eine Lebensraumverbesserung für unsere Wildtiere ermöglichen. Mit etwas gutem Willen kann viel erreicht werden!






































